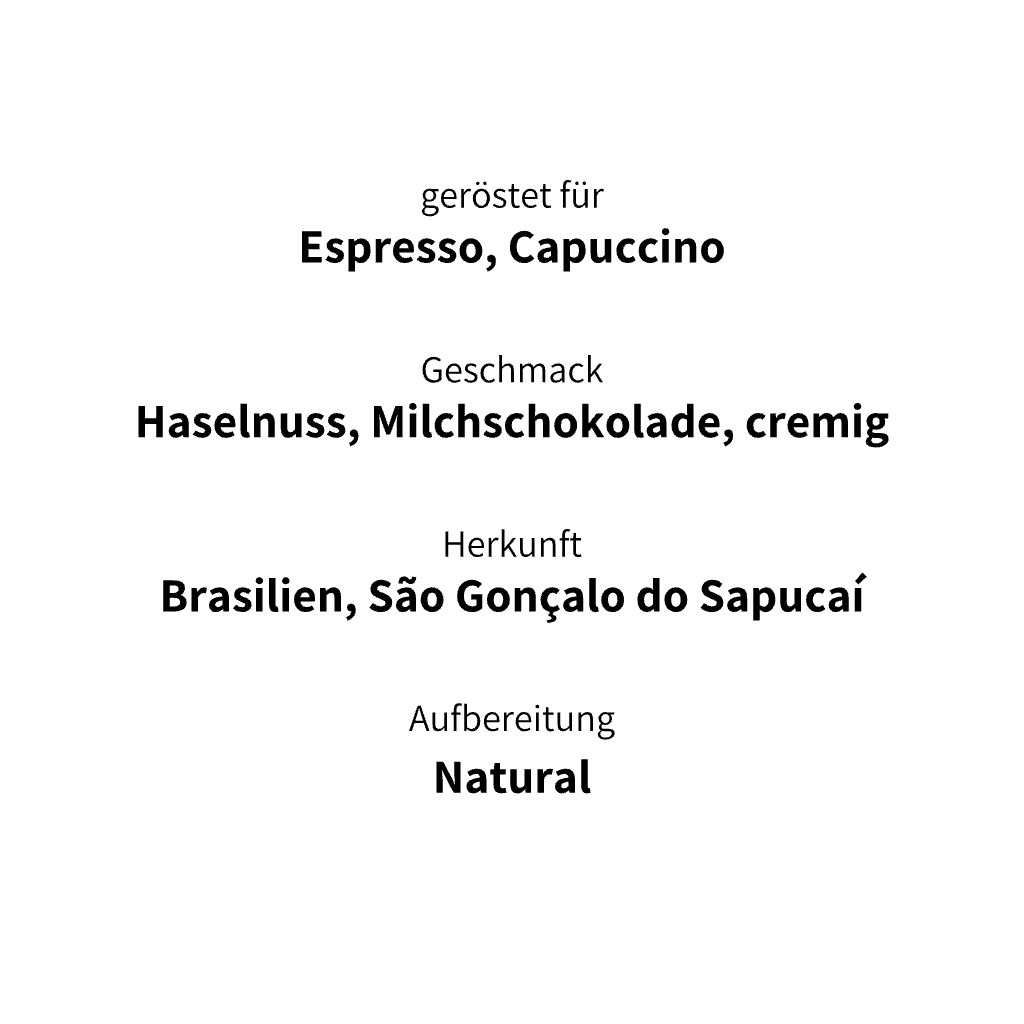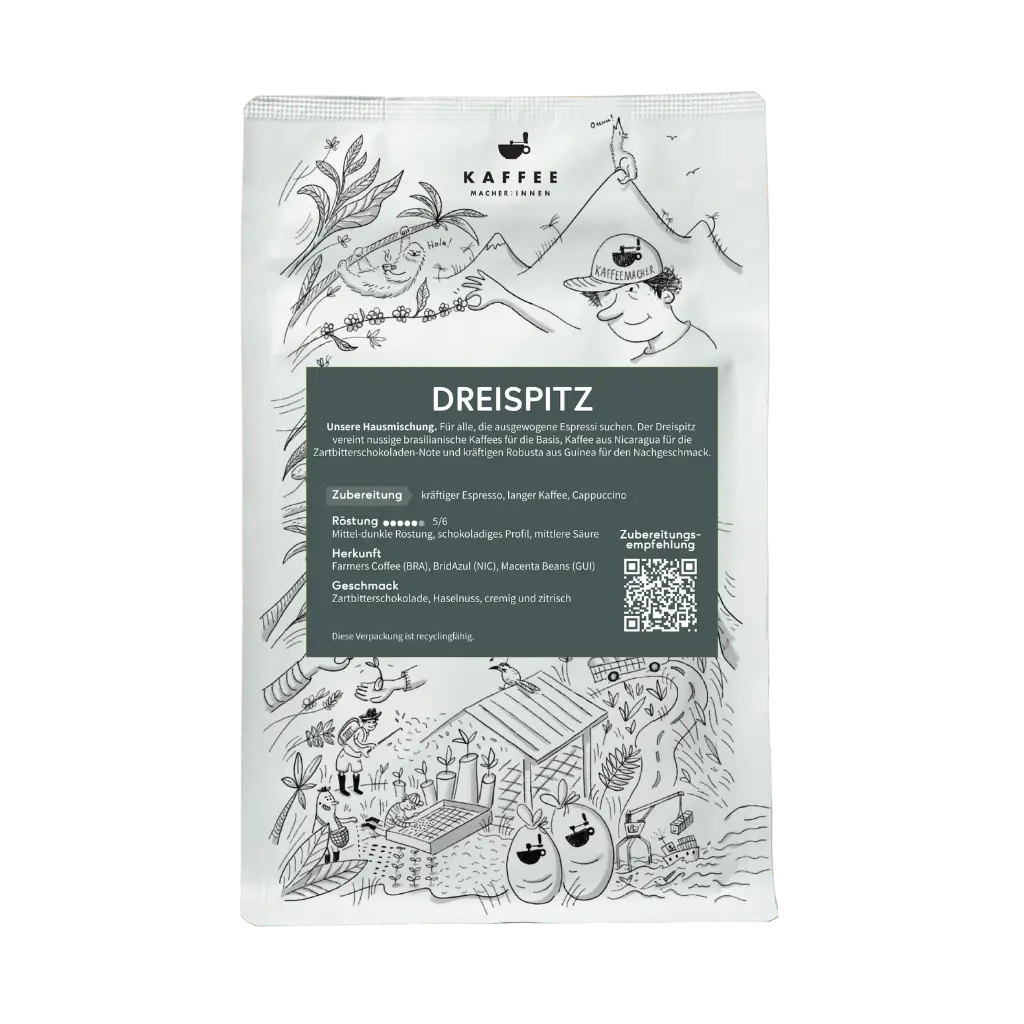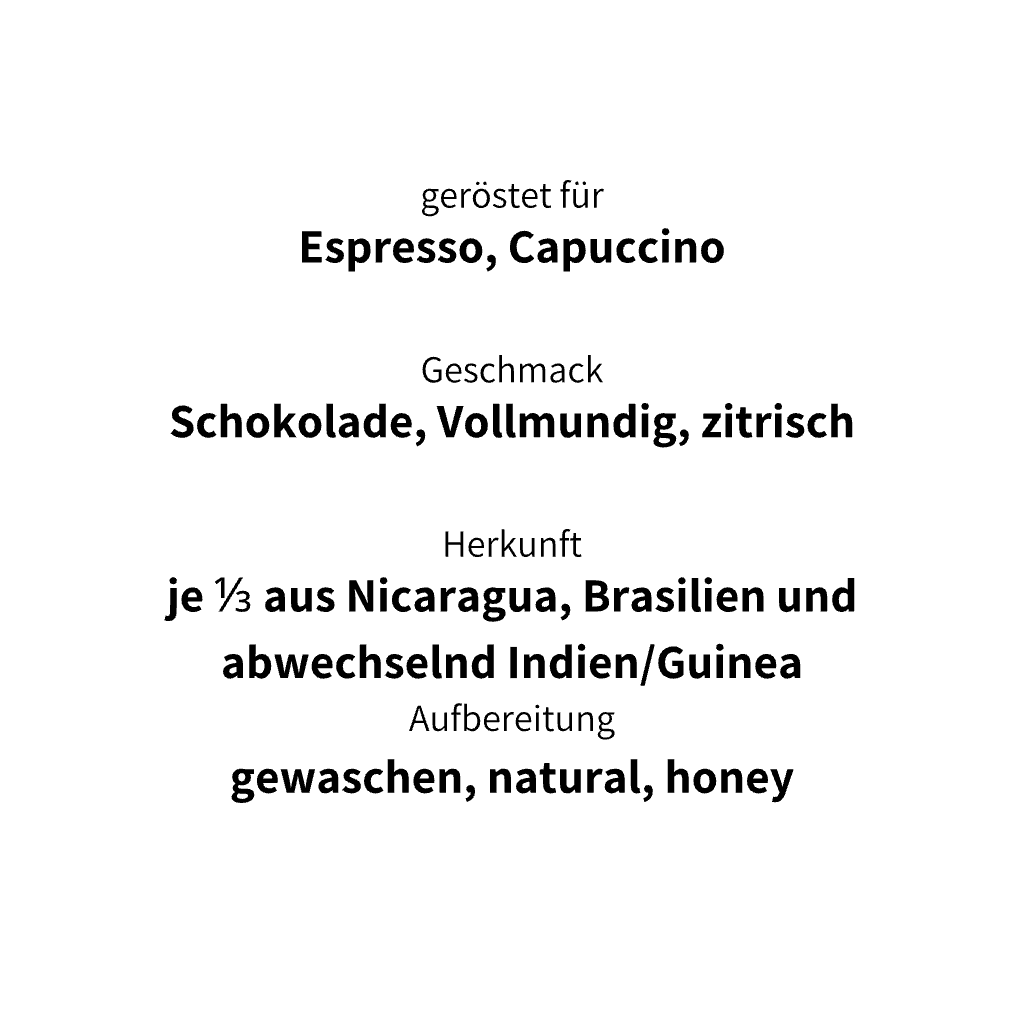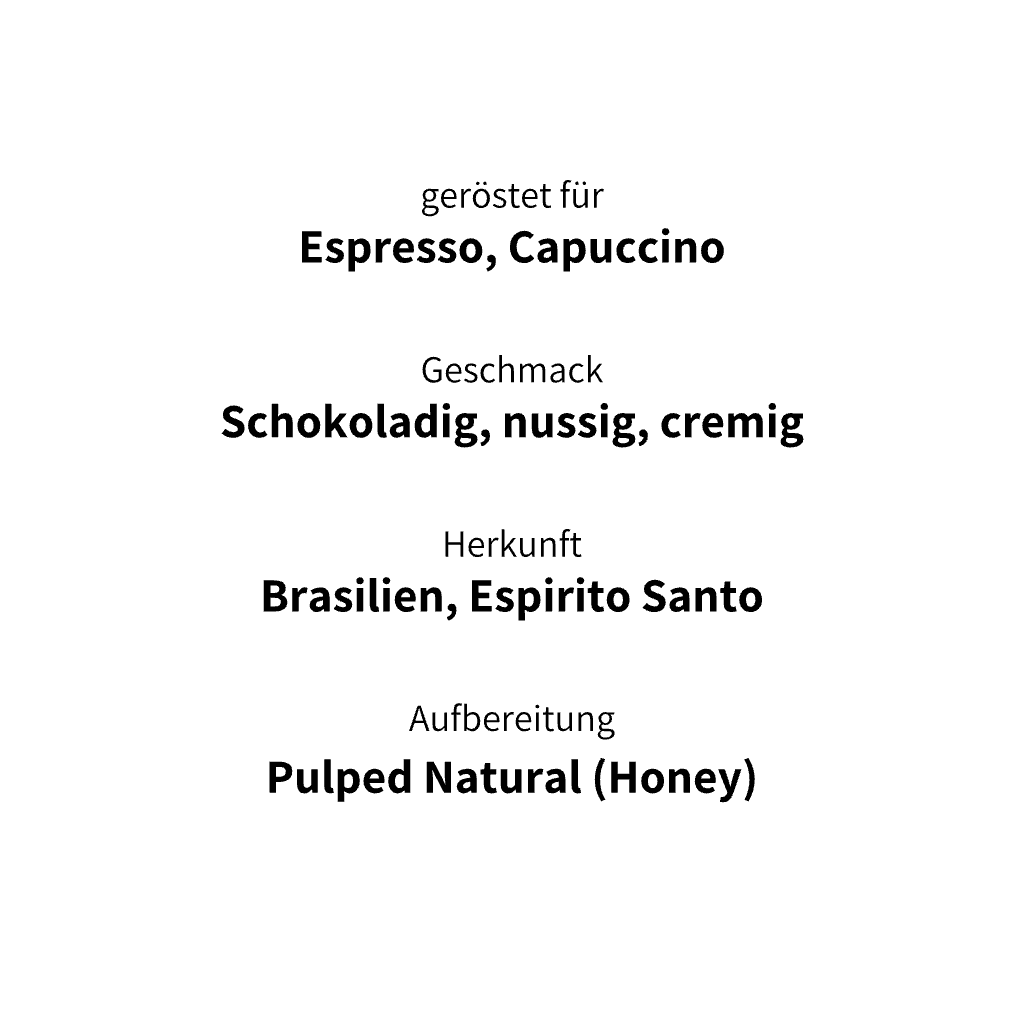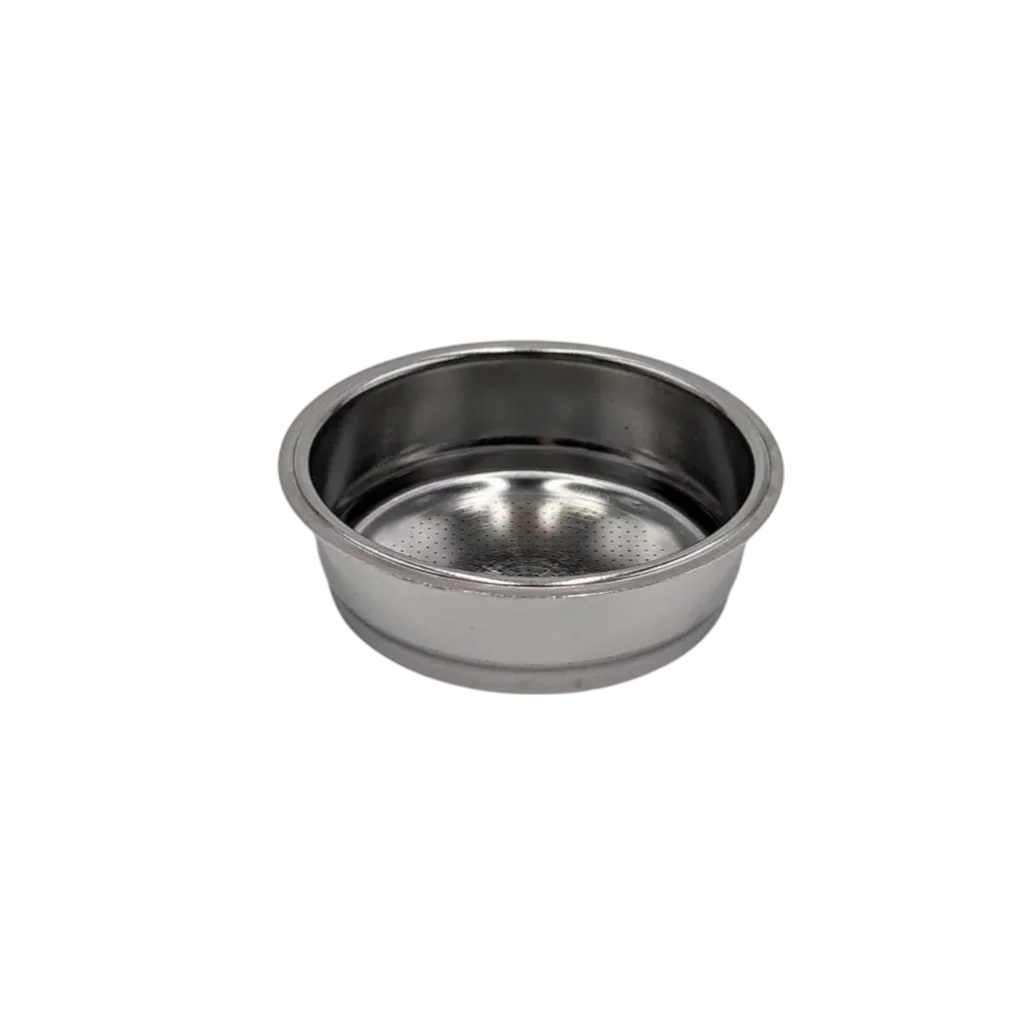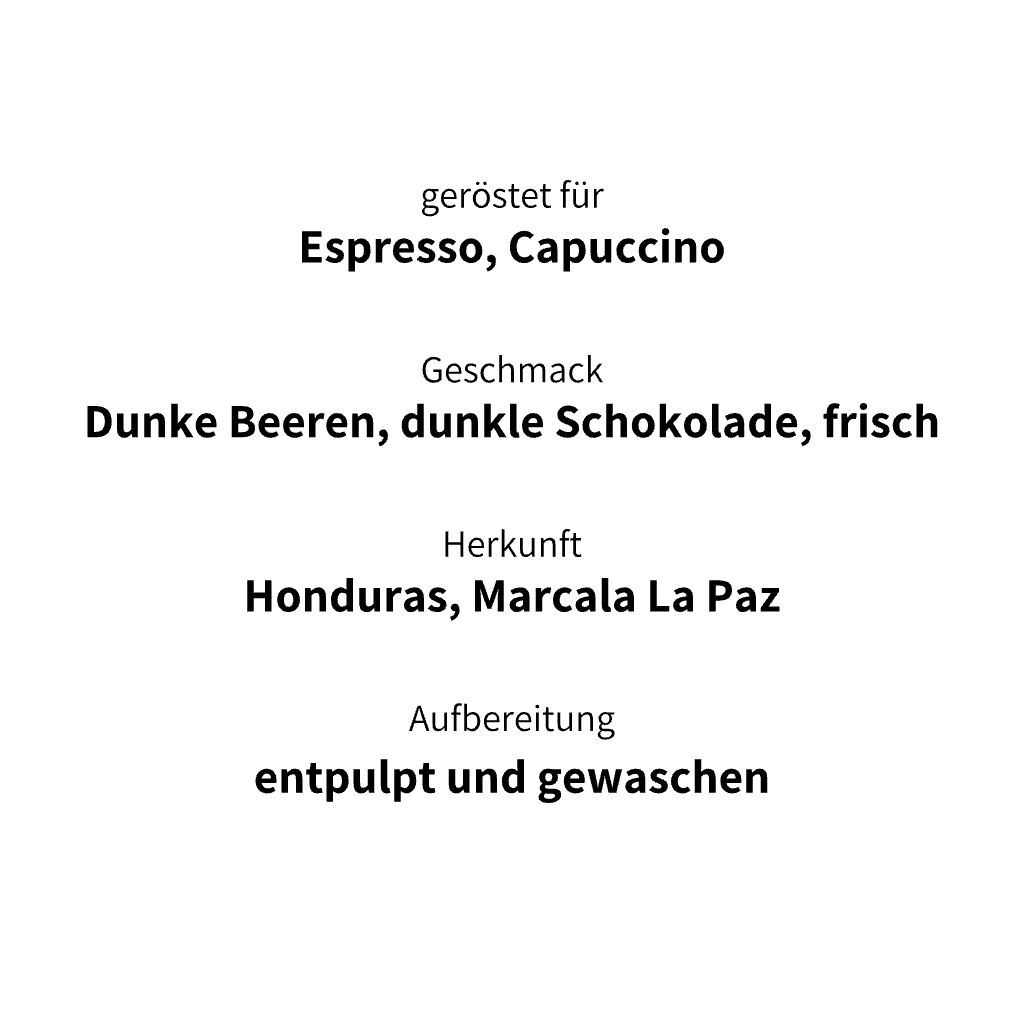Transparenz ist ein geflügeltes Wort in der Kaffeewelt. Röstereien werben damit, Label versprechen sie und Konsumenten fordern sie, oft ohne genau zu wissen, was sie bedeutet. Häufig wird sie auf eine einzelne Zahl reduziert: den FOB-Preis. Doch ein Preis allein, losgelöst von seinem Kontext, sagt viel und gleichzeitig nichts aus. Und trotzdem ist die Transparenz heute wichtiger denn je. Sie ist kein Marketing-Instrument sondern muss eine Grundhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette sein.
Wir trinken fast alle Kaffee, aber fast niemand war je auf einer Kaffeefarm. Das ist auch nicht nötig, um Kaffee wertschätzen zu können. Ebenso ist es nicht nötig, ein Verständnis für die Herstellung des Kaffees zu bekommen, wenn die Geschichte des Kaffees gut vermittelt wird. Doch damit diese Geschichte erzählt werden kann, braucht es Transparenz. Der Begriff ist seit Mitte der 2010er-Jahre allgegenwärtig, wird oft benutzt, aber womöglich nicht immer gleich gedeutet.
Das Missverständnis: Was wir meinen, wenn wir von Transparenz sprechen
Was ist Transparenz?
Der Begriff "Transparenz in der Kaffeekette" bezieht sich darauf, wie offen und nachvollziehbar Informationen über den Weg des Kaffees gemacht werden – von der Farm bis zur Tasse. Es geht darum, Licht in jeden einzelnen Schritt dieser komplexen Lieferkette zu bringen.

Informationen sind vorhanden, aber sie werden nicht immer geteilt
Kurz gesagt, Transparenz bedeutet, die gesamte Geschichte des Kaffees offen zu erzählen. Nicht nur, woher er kommt, sondern auch unter welchen Bedingungen er angebaut wurde, zu welchem Preis und mit welchem Einfluss auf Mensch und Umwelt. Es geht über Labels hinaus und versucht, eine tiefere Verbindung vom Anfang bis zum Ende der Kaffeekette herzustellen.
Der Handel mit Kaffee war Jahrhunderte lang nicht transparent. Denn wo Transparenz fehlt, fehlt auch die Rechenschaftspflicht. Kaffee war ein klassisch koloniales Produkt, das in Sklavenarbeit produziert wurde. Bis weit ins 20. Jahrhundert wurden Menschen in die Kaffeeproduktion gezwungen. Und bis heute produzieren Menschen in gewissen Regionen Kaffee aus Mangel an Alternativen und sind in abhängigen Strukturen gefangen. Aber es geht eben auch anders: Dann, wenn transparent gearbeitet und darüber kommuniziert wird.
Gibt es denn mehr Nachfrage nach transparent gehandeltem Kaffee?
Nicht direkt.
Es gibt einen deutlichen Aufwärtstrend für Fairtrade-Kaffees. In Deutschland stieg der Umsatz im Jahr 2024 um 13 % und hat einen Marktanteil von 5,3 %. In der Schweiz tragen 18 % aller verkauften Kaffee das Fairtrade-Label und 2024 stieg der Absatz um 22 %.

Aus dem Fairtrade Wirkungsbericht 2024/25
Die neueste Studie des DKV zeigt jedoch: Eine deutliche Mehrheit der Befragten interessiert sich kaum für die genauen Hintergründe der Kaffeeproduktion. Weiterhin dominieren Geschmack, Stärkegrad und Preis das allgemeine Kaufverhalten. Nur für 42 % der Probanden war das Thema “Nachhaltige Erzeugung” wichtig bis sehr wichtig, während für 67 % der Preis wichtig war.
Vielleicht ist das Thema Transparenz eher eines für den Kleinröster- und Spezialitätenkaffee-Markt, da oft die Vorstellung herrscht: Kleine Röstereien sind automatisch transparenter, qualitativer Kaffee ist per se nachhaltiger und die Nennung der genauen Herkunft schafft genügend Nähe und Vertrauen.
Keine der drei genannten Ideen würde ich jedoch bestätigen.
Die Größe und die qualitative Ausrichtung der Rösterei spielen keine Rolle, wie transparent jemand arbeitet. Die genaue Herkunft zu nennen, ist heute lediglich eine Entscheidung der Kommunikation – die Informationen sind bei den meisten Röstereien vorhanden. Auch die Gleichung "hohe Qualität = hohe Nachhaltigkeit" geht nicht auf.
Ich habe qualitativ fantastische Kaffees von Farmen getrunken, die massiv Glyphosat einsetzen und Arbeiterrechte vernachlässigen. Und ich habe richtig schlechten Kaffee von Farmen getrunken, die im Sinne der nachhaltigen Kaffeeproduktion ein Kompass für viele andere sein könnten.
Ist Transparenz nachhaltig? Die Entwirrung der Begriffe
Schon bis hier wird klar: Der Transparenz-Begriff vermischt sich mit Ideen der nachhaltigen Produktion, fairer Bezahlung und guter Partnerschaften. Damit wird der Begriff aufgeladen und unpräzise.
Transparenz ist kein Konzept, sondern ein Instrument, um die aufgeführten Ziele überhaupt erreichen zu können. Wie eine PV-Anlage ein Instrument ist, eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen, befähigt uns Transparenz, Dinge zu sehen. Mehr nicht. Unternehmen, die Transparenz als Werkzeug nutzen, können weit über das Sehen hinausgehen und mit der klaren Sicht Veränderungen anstoßen.

Ein neues Sehen ist gefragt. La Capilla, Coscomatepec, Mexiko
Eine transparente Haltung schafft die Grundlage, überhaupt nachhaltiger agieren zu können. Es ist das Fundament für Vertrauen, langfristige Beziehungen und Authentizität. Und genau darum ist Transparenz heute wichtiger denn je: Sie ist die Grundlage für gute und stabile Beziehungen an jeder Schnittstelle der Kette.
Wie der Markt Transparenz erzwingt: Der Preis im Wandel
Kaffee wird immer gehandelt, weil es ein cash crop ist. Eine landwirtschaftliche Kultur, die zu Verkaufs- oder Exportzwecken und somit zur Gewinnerzielung gepflanzt wird, also cash (Geld) durch das crop (angepflanzte Kultur) bringen soll.
Die Art, wie Kaffee verkauft und gekauft, also gehandelt wird, unterscheidet sich in dem, wer mit wem verhandelt und auf welcher Basis einen Preis ausmacht. Eine große Kooperative in Brasilien sucht keine kleinen Röstereien als Käufer, die nur Säcke und keine Container kaufen, während ein großer Händler aus Gründen der Kleinteiligkeit keine Kleinstproduzenten in das Portfolio aufnimmt.
Der C-Price ist immer Bestandteil einer Verhandlung des Preises zwischen Käufer und Verkäufer. Als im Herbst 2024 der Rohkaffeepreis einen Höchststand nach dem anderen erreichte, wurde der Welt klar, dass auch Spezialitätenröstereien von diesem C-Price betroffen sind. Es ist nicht so, dass Qualitäts-orientierte Röstereien immun davon sind, im Gegenteil: Alle sitzen im gleichen Boot. Und das ist gut so.
Der C-Price ist aber nicht der kostenwahre Preis für Rohkaffee. Er reflektiert das Angebot und die Nachfrage, was vom realen Kaffeevorkommen, von Volumenschätzungen und von Spekulationen bestimmt wird.
Der C-Price ist öffentlich und Kaffeeproduzenten kennen oft die kleinsten Schwankungen viel besser als viele Röstereien. Denn: geht der Preis hoch, warten Produzenten mit dem Verkauf. Geht er dann wieder runter, tendieren sie zu verkaufen.
Eine neue Verhandlungskultur durch hohe Preise
Spätestens seit den höheren Kaffeepreisen mussten sich viele Käufer noch mehr mit dem C-Price auseinandersetzen. Es wurde klar, dass niemand unabhängig davon agiert, egal wie stabil eine Beziehung zu Kaffeeproduzenten aufgestellt ist. Und deswegen rückte der C-Price derart stark ins Zentrum der Verhandlungen, dass es ein neues Verständnis für Preise gab.
Jahrelang haben vor allem Spezialitätenröstereien gesagt, dass der C-Price viel zu gering ist, um davon als Produzent leben zu können. Jetzt ist er hoch, und das stellt die Röstereien vor eine Herausforderung, da sie die Preise anheben müssen, was die Sorgen vor abspringenden Kunden nährt.
So erlebte ich in den letzten Monaten, wie viele Einkäufer und Verkäufer so stark über Preise und einzelne Cents diskutierten, wie nie zuvor. Röstereien (Einkäufer) mussten vorrechnen, wie viel sie mit den Preisen nach oben gehen müssen, Verkäufer (Händler, Produzenten, Kooperativen) haben argumentiert, wie hoch die lokalen Preise sind, wie wenig ihre Marge darstellt und wie hoch das Risiko für Kredite ist.

Informationenaustausch in beide Richtungen. Apas zu Besuch bei uns in Basel
Der hohe C-Price hat damit zu mehr Transparenz bei der Preisfindung gesorgt. Verkäufer und Einkäufer haben ihre Zahlen so offen kommuniziert wie noch nie zuvor. Und dieses Wissen ist nun da. Ich bin überzeugt, dass wir als Branche nicht in ein prä-2024 Zeitalter zurückfallen werden, weil der starke Preisdruck einen Wissensruck mit sich zog, der jetzt maßgebend ist. Die Preisverhandlungen werden ab heute transparenter verlaufen.
Noch lange nicht transparent genug: Auf dem Weg zum kostenwahren Preis
“Open book” war für viele Einkäufer die Devise in den letzten Monaten und haben ihre Zahlen mit Verkäufern geteilt. Das war vor wenigen Monaten unvorstellbar. Die Sorgen der Einkäufer zwangen sie, transparenter zu kommunizieren. Und trotzdem bleibt der kostenwahre Preis unangetastet. Der Verkaufspreis, der alle Kosten der Produktion, einschließlich sogenannter externalisierter Kosten wie Umweltbelastungen, berücksichtigt.

Selbst hergestellter Bio-Dünger bei Apas in Brasilien
Das muss der nächste Schritt sein, um ein wirklich transparentes Pricing zu bekommen. Dazu gehört die Erfassung, was denn ein gutes Einkommen für Produzenten ist. Das “gute Einkommen” kann nicht von Röstereien oder einem C-Price bestimmt werden.
Produzenten würden in einer perfekten Welt entscheiden, was sie bräuchten, der C-Price bleibt aber die Referenz. Um aber ein realeres Verständnis zu bekommen, wie der C-Price einzuordnen ist, helfen Tools wie der Living Income Benchmark von Fairtrade. Der kann helfen, kontextualisierte Zahlen zu bekommen, was plausibilisierte Löhne in gewissen Regionen der Welt sein könnten. Des Weiteren bräuchte es die Kenntnis der Produktionskosten, eine Marge, plus die externen Kosten, um einen umfassenden Preis für Rohkaffee berechnen zu können.
Das ist ein langer Weg und da braucht es mehr Transparenz für alle Beteiligten auf der Kaffeekette, um diese Fragen beantworten zu können. Für die richtige Preisbildung ist Transparenz unabdingbar. Darüber hinaus müssen wir uns fragen:
wem bringt Transparenz eigentlich etwas?
Für wen ist Transparenz entscheidend? Verschiedene Perspektiven
Natürlich gibt es Grenzen der Transparenz.
Wenn wir über Transparenz auf der Kaffeekette reden, implizieren wir damit Handelspraktiken, bezahlte Preise, Anbaumethoden, vielleicht Arbeitsverhältnisse und Umweltbelastungen. Meistens sind das Themen, die den Anbau betreffen.
Röstereien, die viel Transparenz von Händlern und Produzenten einfordern, sind eingeladen, ebenso viel Transparenz von sich zu zeigen. Als Grundsatz könnte hier doch gelten:
Das Maß an Transparenz, das ich von dir einfordere, werde ich auch dir geben.
Und damit setzt man sich selbst die Grenzen der Transparenz, weil es vielleicht Themen gibt, über die man nicht gerne spricht. So finden sich auf der Kette dann die Seinesgleichen.
Was haben die einzelnen Akteure auf der Kette von Transparenz?
Nehmen wir mal an, dass das größtmögliche Maß an Transparenz auf einer bestimmten Kaffeekette angewendet wird, sich damit alle wohl fühlen und der Informationsaustausch in beide Richtungen geht - from seed to cup und from cup to seed. Oft herrscht eine Informationsasymmetrie. Wenn diese aber durchbrochen wird, gibt es Chancen für alle Beteiligten.
Wenn die Informationsasymmetrie durchbrochen wird, gibt es Chancen für alle:
Produzenten:
- Ermächtigung durch Wissen über den Wert ihres Produkts und die Möglichkeit zur Verhandlung fairer Preise über die Produktionskosten hinaus.
- Zugang zu direkten, langfristigen Partnerschaften, die Stabilität und Investitionen in nachhaltige Anbaumethoden ermöglichen.
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen und fairer Löhne für Farmarbeiter, die oft unterbezahlt sind
Rohkaffee-Importeure:
- Ihre wichtige Rolle als Brückenbauer zwischen Produzenten und Röstern, die Logistik und Qualitätssicherung managen.
- Die Möglichkeit, durch eigene Transparenz (z.B. über ihre Margen und Dienstleistungen) Vertrauen in der gesamten Kette zu stärken.
- Risikomanagement durch detaillierte Kenntnis der Herkunft und Produktionsbedingungen.
Kaffeeröster:
- Aufbau einer starken Marke und Glaubwürdigkeit durch authentische Geschichten und nachvollziehbare Herkunft.
- Verbesserung der Einkaufsstrategien durch tiefere Einblicke in die Kostenstrukturen der Produzenten und Optimierung der Lieferkette.
- Differenzierung im Wettbewerb und Anziehung einer bewussten Kundschaft, die Wert auf ethischen Konsum legt.
Kunden:
- Möglichkeit, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen, die ihren persönlichen Werten entsprechen (z.B. Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit).
- Verständnis für den "wahren Preis" des Kaffees, der die sozialen und ökologischen Kosten entlang der Wertschöpfungskette widerspiegelt ("True Pricing").
- Wertschätzung des Produkts und der Arbeit hinter jeder Tasse Kaffee durch detaillierte Herkunftsinformationen.
Transparenz richtig deuten. Die Notwendigkeit von Kontextwissen
Wer zwei 87 Punkte-Kaffees vergleicht, einmal aus Kenia und einmal aus Brasilien, weiss, dass diese 87 Punkte anders schmecken. Die Kaffees aus Kenia und Brasilien schmecken grundverschieden, können aber hohe Bewertungen der einzelnen Geschmacksattribute aufweisen und so auf 87 Punkte kommen.
Same score, different reason, sagen wir oft bei Verkostungen.
Wenn ich aber nur die 87 Punkte kommunizieren würde, ohne den Kontext der Herkunft, Varietät, Aufbereitung etc., dann sagt mir das zwar aus, dass der Kaffee wohl sehr gut ist. Ich weiß aber immer noch nicht, wie er schmeckt, für welchen Zweck er passen könnte und wem er sonst noch schmecken könnte.
Ebenso wenig sind nackte Zahlen und Fakten in der Transparenzdebatte hilfreich. Ein isoliert betrachteter FOB-Preis, die Art der Ernte und der Verarbeitung, die Eigentumsstrukturen auf der Kette - alles Informationen, die ohne Kontext wenig aussagen. Zwei Beispiele dazu:

Don Roque produziert hochwertigen Kaffee, der Ertrag pro Hektar ist unter 1 Tonne
Hoher Preis für einen guten Kaffee:
Kleinstproduzenten in der Bergregion Oaxaca, Mexiko, sind oft vollständig von ihrer kleinen Ernte abhängig. Das macht den Kaffee exklusiv und teurer. Ein höherer Preis ist hier für ihr Überleben notwendig und wird durch Knappheit bestimmt, nicht allein durch die Qualität in der Tasse.
Günstiger Preis für einen super Kaffee:
Ein fantastisches Lot eines kolumbianischen Produzenten mit über 100 Hektar Land wurde qualitativ höher bewertet, war aber preislich identisch mit dem Oaxaca-Kaffee. Durch Größe, Effizienz und moderne Fermentation in großen Tanks konnte der Kaffee günstiger produziert werden.
Die Preise waren identisch, hatten aber keinen direkten Bezug zur Sensorik, sondern zu den Skaleneffekten und Anbaumethoden. Ohne Kontext ist ein Preis nur eine Zahl.
Was sagen Preisangaben wie FOB wirklich aus?
Initiativen wie "The Pledge" luden 2018 Röstereien ein, um FOB-Preise zu teilen, um Transparenz in die Preisfindung zu bringen. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, so dass ein kleiner Ruck durch die Spezialitätenwelt ging. Bis heute teilen viele Röstereien ihre Einkaufspreise auf der FOB-Basis.
"FOB sei erst der Anfang”, steht in der Vision von 2019. Erst wenn alle Preise auf der Kaffeekette transparent werden, gibt das die Möglichkeit, einen Living Income Price oder sogar den kostenwahren Preis zu berechnen.
Der FOB Preis (free on baord) bedeutet, dass der Exporteur alle Kosten bis zur Verladung auf das Schiff trägt. Sobald der Kaffee auf dem Schiff ist, gehen die Folgekosten zur Import-Seite. Ein Exporteur kann, muss aber nicht der Produzent selbst sein.
Davor und danach fallen weitere Kosten an, die in unterschiedlichen Preismodellen abgebildet werden:
Gehalt für Pflücker
Taucht in klassischen Preismodellen nicht auf, ist aber in den Farmgate-Preis einkalkuliert. Dazu gibt es einen Anhaltspunkt, den “Living Wage” Ansatz, der sich vom “Living Income” unterscheidet: Während der “living wage” das Angestelltenverhältnis abbildet, ist das “living income” die Referenz für den selbständigen Erwerb. Zur Ermittlung des Gehalts für Pflücker dient daher der “living wage” Ansatz, für Farmbesitzer der “living income”.
Ex-Farmgate
Der Preis, den ein Produzent für den Kaffee direkt ab Farm erhält.
FOT (Free on Truck)
Der Preis, nachdem der Kaffee von der Trockenmühle zum Hafen transportiert wurde und dort den Besitzer wechselt.
FOB (Free on Board)
Der Preis, wenn der Kaffee auf das Schiff verladen ist. Der Exporteur trägt alle Kosten bis zu diesem Punkt.
DDP (Delivered Duty Paid)
Der Preis für den Kaffee, wenn er verzollt und versteuert an der Türschwelle der Rösterei ankommt.
Die genannten Kosten sind sogenannte Incoterms: Definition, die fest legen, wer welche Kosten trägt und wann die Güter übergeben werden. Des Weiteren geben Incoterms Auskunft darüber, ob die Ware vom Käufer oder Verkäufer weiterbefördert wird.

Jede Kaffeekette hat ihre Eigenheiten und funktionieren oft nie identisch.
Den Incoterms liegen Kaffee-Lieferketten zu Grunde, die sich oft ähneln, sich im Detail aber unterscheiden. Ein paar Eigenheiten können sein:
- es ist nicht eine einzelne Produzentin, sondern sie ist Teil einer Organisation (z.B. Kooperative)
- einzelne Produzenten besitzen i.d.R. keine Dry Mill, also die Anlage, wo der Kaffee exportfähig gemacht wird
- der Service der Dry Mill kann eingekauft werden, oder die Dry Mill kauft den Kaffee ab und exportiert ihn
- Kooperativen oder Exporteure (Händler) besitzen i.d.R. Dry Mills
- der Exporteur braucht immer ein Gegenüber, den Importeur, der den Kaffee dann abkauft. Das können Tochterfirmen oder unabhängige Firmen sein.
Deshalb die Fragen:
Was sagt der FOB-Preis also aus?
Ohne Kontext nicht viel.
Die Grundidee der FOB-Kommunikation ist ja die, dass man irgendwann so viel Transparenz hat, um das Living Income berechnen zu können. Dafür reicht aber weder der FOB-Preis noch der ex-Farmgate Preis nicht. Es braucht präzisere Berechnungen, die sich mit den individuellen Lebenswelten vor Ort beschäftigen.
Der FOB-Preis ist in dem Fall, ohne Kontext, einfach mal eine Zahl. Und nur weil eine Rösterei diesen Preis kommuniziert, kann noch nicht davon ausgegangen werden, dass es ein guter Preis für Produzenten wäre.
Ich sehe immer wieder, dass Röstereien den FOB-Preis angeben mit der Zusatzinfo, dass der bezahlte Preis um ein x-faches über dem C-Price (dem Börsen-Referenzpreis) liegt. Ich glaube, dass dies zwei Dinge bedeutet:
- den Willen, transparent zu kommunizieren, was es braucht und löblich ist
- die Absicht, eine andere Kommunikation zu fahren, was aber unvollständig ist, wenn nicht kontextualisiert wird
Context is king - solange der FOB-Preis alleine steht, bedeutet das nicht viel. Erst die Erfassung weiterer Datenpunkte gibt ein vollständigeres Bild, wie der Kaffee gehandelt wurde.
Ein FOB-Preis von 10 USD pro Pfund Rohkaffee scheint hoch. Wenn der Ex-Farmgate-Preis aber bei nur 5 USD lag, bedeutet das, dass die Kosten für Verarbeitung, Logistik und Exportmarge den Preis verdoppelt haben – ein enormer Aufschlag. Nur weil eine Rösterei den FOB-Preis kommuniziert, ist das keine Garantie für einen fairen Preis für Produzenten.
Hier sind unsere FOB-Preise, die wir für Rohkaffees bezahlen.
Ist transparent auch fair?
Wie eingangs erwähnt, ist Transparenz ein Instrument, das uns hilft, überhaupt zu begreifen, was in einer langen Handelskette alles passiert. Wo ein Produkt mit monetären und ideellen Werten aufgeladen wird, wessen Beitrag auf der Kette das Produkt verbessert und was wir ausgehend davon weiter lernen können.
Transparenz ist notwendig, aber alleinstehend keine Erklärung für ein tiefergehendes Verständnis einer Warenkette. Ebenso wenig sind transparente Infos ohne darauffolgende Handlung keine Garantie für Fairness.
Ein ethisches Dilemma kann dann auftauchen, wenn wir uns in einer Informationsasymmetrie befinden; dann, wenn der eine Teil auf der Kaffeekette mehr über den Markt und mehr über den anderen Teil weiß, als umgekehrt. Das Ziel sollte dementsprechend sein, dass die Vorteile der Transparenz die Produzenten auch erreichen und so gemeinsam an Lösungen gearbeitet werden kann.
Die Zukunft der Transparenz
Kaffeeunternehmen, die berichtspflichtig gegenüber Dritten sind, z.B. einer Labelorganisation wie Fairtrade oder Rainforest Alliance, oder auch Aktionären, müssen per se transparenter arbeiten als viele kleinere Unternehmen und zeigt oft einen höheren Grad an Präzision.
Ob diese Infos dann auch mit den Kunden und Produzenten geteilt werden, ist eine andere Geschichte. Die Übung, mehr über die eigene Kette zu erfahren, wird aber vor allem bei größeren Firmen schon lange gemacht. Wer davon schließlich profitiert, ist unklar.
Damit Wandel also überhaupt geschehen kann, braucht es Transparenz über die ganzen Lieferketten hinweg. Allen voran braucht es aber das Selbstverständnis, wie wir uns als Unternehmen, Privatpersonen und Institutionen zur Transparenz stellen. Wenn sie die Leitplanke für unser Handeln darstellt, wir sie in beide Richtungen denken ("ich teile so viel, wie ich erfrage") und sie als kreatives Mittel für Veränderungsprozesse sehen kann, dann ist sie ein starkes Tool für eine zukunftsfähige Kaffeekette.